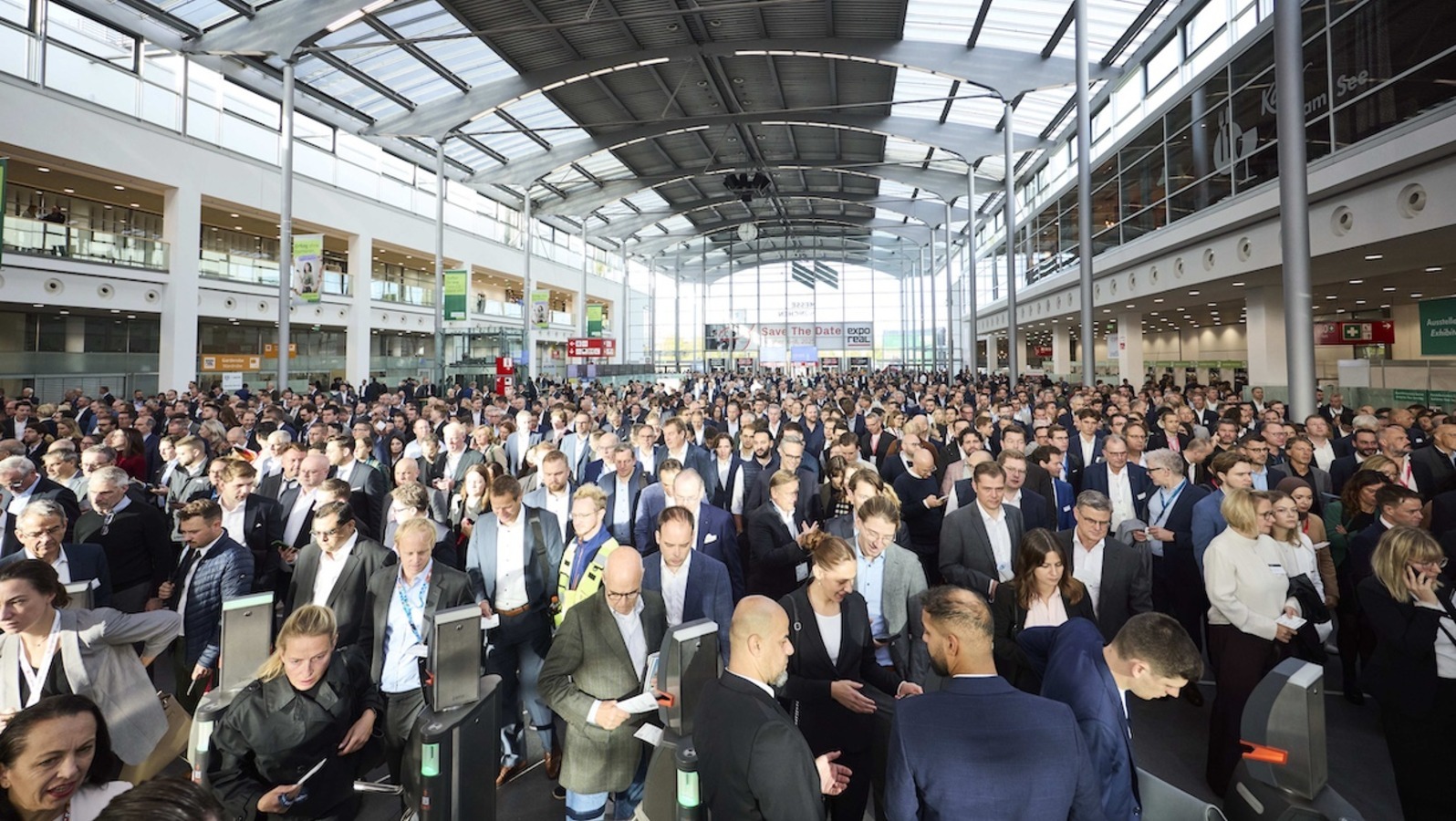Durch die Weiterentwicklung und Weiterverbreitung der KI geht der Trend ganz klar Richtung Rechencenter. In den kommenden Jahren wird die Nachfrage nach Speicher- und Rechenkapazitäten sowie passenden Immobilien kontinuierlich steigen. „Nach einer Analyse von TMT Finance lag der durchschnittliche Wert des globalen Rechenzentrumsmarkts im Jahr 2024 bei rund 300 Milliarden US-Dollar“, sagt Birgit Kraml, Partnerin und Head of Real Estate bei DLA Piper Österreich. TMT Finance geht davon aus, dass die Wachstumsrate in den nächsten fünf Jahren weltweit im Schnitt bei zehn Prozent pro Jahr liegen wird. Prognosen zeigen, dass die generierte Datenmenge auf dem Globus bis 2027 auf über 284 Zettabyte ansteigen wird. „Das erfordert eine massive Skalierung der Datacenter-Infrastruktur – ein Markt mit enormem Potenzial“, blickt Karsten Jungk, Immobilienbewerter von Wüest Partner, in die sehr nahe Zukunft.
Städte und Lagen
„Betrachtet man die Standorte in Europa, wo tatsächlich wesentliche Investitionen in Rechenzentren erfolgen, so konzentrieren sich diese tendenziell im geografischen Norden, etwa ab Frankfurt/Main nordwärts“, meint Astrid Grantner-Fuchs, Geschäftsführerin bei EHL Immobilien Bewertung. Gemäß einer JLL-Studie wird Europa dabei von den sogenannten FLAP-D-Märkten (Frankfurt, London, Amsterdam, Paris und Dublin) geprägt. Nicht zuletzt hat das mit dem bevorzugten Standortfaktor eines gemäßigteren, kühleren Klimas zu tun. Darüber hinaus punkten diese Lagen mit der Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien und Kühlwasser sowie einer sehr guten Sicherheitslage. Astrid Grantner-Fuchs: „Zusammen mit der Anbindung an internationale Netzwerkknoten sind das die wesentlichsten Standortfaktoren.“
Regularien und Österreich
Datacenter siedeln sich in größeren Siedlungsgebieten an, somit nahe an Anrainern. Neben dem Thema Anrainer – die in der Regel keine „Kraftwerke“ in ihrer Nähe wollen – spielen die jeweilige Widmung und die regulatorischen Voraussetzungen ebenso eine Rolle wie Energieversorgung und Energiekosten. Österreich sei bei den meisten dieser Punkte leider eher Schlusslicht als vorne dabei, blickt Birgit Kraml auf die heimische Realität: „Es werden hierzulande zwar oft und gerne Grundstücke für die Errichtung von Datacentern angeboten, meist sind diese aber noch nicht entsprechend gewidmet, und in den allermeisten Fällen steht die Energieversorgung noch in den Sternen.“ Aber gerade diese ist das Um und Auf. Internationale Datacenter-Betreiber suchen Opportunitäten für 100 bis 300 Megawatt. „Wir sprechen hier von Mengen, die durchschnittlich von österreichischen Kleinstädten verbraucht werden“, so die Rechtsanwältin von DLA Piper.
Energieeinsatz und ESG
Betrachtet man diesen Energieeinsatz, so ist es naheliegend, dass ESG oberste Priorität hat. Sowohl für die Investition in Rechenzentren als auch für deren Betrieb spielen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz eine wachsende Rolle. „Höhere Mieten werden nur für moderne Rechencenter mit Severn mit weniger Energieverbrauch verlangt werden können“, erklärt Birgit Kraml: „Effizienzgewinne werden daher die Investitions- und Nutzungsentscheidungen bestimmen, veraltete Technologien werden konsolidiert werden müssen.“
Interessant für Investoren
Rechenzentren gewinnen auch als Anlageprodukte an Bedeutung und rücken als kommende Assetklasse immer mehr ins Zentrum des medialen Interesses. „Als RICS-zertifizierter Bewerter kommt man spätestens 2011 mit einer entsprechenden Bewertungsguideline in Berührung“, erklärt Astrid Grantner-Fuchs. 2024 wurde die Guideline adaptiert. Die EHL-Bewertungsspezialistin erklärt: „In Abhängigkeit vom Betriebsmodell differenzieren sich die Rechenzentren in vielfältigen Abstufungen vom Owner-Occupier-Modell – das heißt, der Eigentümer ist auch gleichzeitig Betreiber – bis hin zu Varianten, in denen nur die Gebäudehülle zur Verfügung gestellt wird.“ Dementsprechend gestalten sich auch die Bewertungsansätze, die eine tiefgehende Analyse des dahinterliegenden Businessmodells voraussetzen. Am österreichischen Markt fehlen echte Vergleichskennzahlen für Mieten oder Renditen. Auch aus Deutschland liegen kaum belastbare Benchmarks vor. Kolportiert werden europaweit Renditen im Bereich von fünf bis sieben Prozent. Für Astrid Grantner-Fuchs liegt der Grund für fehlende Benchmarks darin, „dass Rechenzentren zumeist nach dem Owner-Occupier-Modell errichtet werden“.
Renditen werden steigen
Ob Rechenzentren als Investment-Immobilie oder Infrastruktureinrichtung gesehen werden, spielt für die Renditen keine Rolle. Greg Kane, Head of European Investment Research bei PGIM Real Estate, geht davon aus, „dass die Renditen auf dem Markt für Rechenzentren in den nächsten Jahren voraussichtlich um zehn bis 15 Prozent pro Jahr steigen werden, was auf das anhaltende Mietwachstum zurückzuführen ist, da die Mieter um Flächen konkurrieren.“ Aus Umfragen von PGIM unter Investoren geht hervor, dass fast ein Drittel in den Rechenzentrumssektor investieren will, verglichen mit nur fünf Prozent der 2018 befragten institutionellen Investoren.
Technik als Gamechanger
Zuletzt zeigte sich aber, dass auch das Geschäftsmodell Rechenzentrum rasch unter Druck geraten kann, und das liegt gar nicht so sehr an dem Gebäude selbst. Die Markteinführung des neuesten KI-Modells des chinesischen Unternehmens DeepSeek hat nicht nur die Businesspläne von Tech-Riesen konterkariert. Kenneth Lamont, Fondsanalyst bei der englischen Firma Morningstar: „Bislang war die gängige Meinung: Die besten KI-Modelle beruhen auf riesigen Datensätzen und immenser Rechenleistung. Doch die jüngsten Innovationen von DeepSeek stellen diese Annahme auf den Kopf, denn dieser Durchbruch senkt die Rechenanforderungen. Sollten die Kosten sinken, wie es das Modell von DeepSeek nahelegt, wird der Stromverbrauch sinken, und auch der Bedarf an Datacentern wird nicht so groß sein wie aktuell erwartet.“